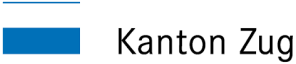Denkmalgeschichten entdecken
Es gibt viele Gelegenheiten, die Zuger Denkmäler zu erleben und mehr über sie zu erfahren. Hier präsentieren wir Ihnen ausgewählte Objekte, die aus denkmalpflegerischer Sicht erfolgreich saniert oder umgebaut werden konnten. Ausserdem erhalten Sie einen Eindruck, was ein Denkmal alles sein kann.

Auf dieser Seite
Auszeichnung für den Umbau des denkmalgeschützten Hauses Seestrasse 1 in Zug

Auszeichnung für den Umbau des denkmalgeschützten Hauses Seestrasse 1 in Zug
Das Haus Seestrasse 1 in der Zuger Altstadt wurde von der Architekturzeitschrift «Hochparterre» mit einem «Silbernen Hasen» prämiert. Die Auszeichnung steht für die sorgfältige Sanierung des komplexen Gebäudes, in dem sich Zeitschichten aus mehreren Jahrhunderten überlagern. Sein Kernbau wurde 1467 in einer Bohlenständerkonstruktion errichtet.
Das Amt für Denkmalpflege und Archäologie untersuchte vor und während des Umbaus das Haus und begleitete die Sanierung und Restaurierung.
Link zum Beitrag im Hochparterre: Die beste Architektur des Jahres (Video Ausschnitt 1:15 - 2:34)
Zeitungsartikel in der Zuger Zeitung zum Herunterladen:
Ein herrschaftliches Haus neu bewohnt
Das Wohnhaus am Sternenweg 9 in Baar wurde um 1768/69 im Auftrag von Johann Jacob Andermatt und dessen Gemahlin Maria Anna Landtwing errichtet. Die Fassaden des Fachwerkbaus sind aussen vollständig verputzt und lassen das Gebäude als Massivbau erscheinen. Die grosszügige Befensterung, das hochaufragende Dach sowie der umliegende Garten tragen zusätzlich zur stattlichen Erscheinung des Gebäudes bei. In den Innenräumen zeugt die reiche Ausstattung aus dem 18., 19. und frühen 20. Jahrhundert von der vornehmen Wohnkultur vergangener Zeitepochen. Dazu gehören ein grosser Bestand an Wand- und Deckentäfern, Türen und unterschiedlich gestalteten Parkettböden, eine Deckenstuckatur sowie ein Stubenbuffet. Besonders wertvoll sind die beiden aus der Bauzeit erhaltenen Kachelöfen mit Inschriften und Familienwappen, die auf die Bauherrschaft des Hauses hinweisen.
Der Umbau des Wohnhauses erfolgte 2023 bis 2024 durch den Architekten Lukas Voellmy. Ziel war es, das Gebäude zu sanieren, das Dachgeschoss auszubauen und in jedem der vier Geschosse eine Wohnung einzurichten. Bei der Aussensanierung wurde darauf geachtet, das Fassadenbild und die historisch wertvolle Bausubstanz weitmöglichst zu erhalten. Im Innern erwies sich die Lage des Treppenhauses in der nordöstlichen Hausecke als Vorteil, da die Wohnungen in den Hauptgeschossen darüber erschlossen werden konnten. Die Fachwerkwände mit Ziermalereien im Treppenhaus und in den Korridoren, die im Rahmen des Umbaus zum Vorschein kamen, wurden restauriert und auf Sicht belassen. Der ebenfalls bei den Bauarbeiten wiederentdeckte Tonplattenboden im Korridor des Obergeschosses wurde aufgefrischt und ist heute wieder sichtbar. Orientiert am historischen Befund, wurden die Wand- und Deckentäfer mehrheitlich zweifarbig mit dunklen Rahmen und hellen Füllungen gestrichen und teilweise holzsichtig belassen. Die wertvollen Parkettböden und Türen sowie das Buffet wurden sorgfältig aufgearbeitet und wieder eingebaut.
Aktuelle Berichterstattung

Ansicht von Südwesten (© Conradin Frei)
Ansicht von Südwesten (© Conradin Frei)

Restaurierte Fachwerkwände im Treppenhaus (© Simon Meyer)
Restaurierte Fachwerkwände im Treppenhaus (© Simon Meyer)

Wiederentdeckter Tonplattenboden im Obergeschoss (© Conradin Frei)
Wiederentdeckter Tonplattenboden im Obergeschoss (© Conradin Frei)

Stube im Erdgeschoss mit Kachelofen von 1769 und holzsichtigem Täfer (© Conradin Frei)
Stube im Erdgeschoss mit Kachelofen von 1769 und holzsichtigem Täfer (© Conradin ...
Stube im Erdgeschoss mit Kachelofen von 1769 und holzsichtigem Täfer (© Conradin Frei)




Ansicht von Südwesten (© Conradin Frei)
Restaurierte Fachwerkwände im Treppenhaus (© Simon Meyer)
Wiederentdeckter Tonplattenboden im Obergeschoss (© Conradin Frei)
Stube im Erdgeschoss mit Kachelofen von 1769 und holzsichtigem Täfer (© Conradin Frei)
Sanierung des Stadtmauerabschnitts beim Kunsthaus Zug
Der Mauerabschnitt zwischen Huwilerturm und Bohlstrasse gehört zur zweiten, äusseren Zuger Stadtbefestigung, die von 1478 bis 1529 errichtet worden ist. Mit den erhaltenen Wehrtürmen und Mauerabschnitten gehört sie bis heute zu den prägnantesten Elementen im Zuger Stadtbild und ist ein wichtiger baulicher Zeuge für die spätmittelalterliche respektive frühneuzeitliche Stadtentwicklung. Der Mauerabschnitt zwischen dem Huwilerturm und dem abgebrochenen Ägeritörli, wo heute die Bohlstrasse durchführt, wurde um 1525 errichtet. Nach 1653/54 wurde die Mauer mit einem hölzernen Wehrgang ergänzt.
Im Rahmen des fortlaufenden Unterhalts der Zuger Stadtmauer beauftragte die Stadt Zug 2021 das Ingenieurbüro Staubli, Kurath und Partner, den betreffenden Stadtmauerabschnitt zu untersuchen und zu sanieren. Ziele der Restaurierung waren die Verlangsamung des Verwitterungsprozesses, die Wiederherstellung der statischen Festigkeit der Mauer und die Festigung des Mauerverbands. Weiter sollte die Mauerkrone für den dauerhaften Schutz vor eindringendem Wasser geschützt und das Holzwerk des Wehrgangs an den schadhaften Stellen instandgesetzt werden. Als erstes mussten Pflanzen entfernt werden, die in das Mauerwerk eindrangen. Danach wurden lose Stellen mit Kalkmörtel aufgefüllt, um den Mauerverband zu festigen. Einzelne Steinschichten wurden mit Ankern gesichert, grosse Fehlstellen mit neuem Material gefüllt. Zudem wurden markante, geschädigte Steine sowie die Schiessscharten des Wehrgangs gefestigt. Die Steine in den oberen Lagen des Wehrgangs mussten ersetzt und neu aufgemauert werden. Der Holzboden des Laubengangs auf der Innenseite der Mauer musste zur weiteren Nutzung erneuert werden, wobei zwei Drittel der noch tauglichen alten Bohlen wiederverwendet werden konnten. Der Treppenaufgang wurde aus statischen Gründen um 1,3 Meter versetzt, was zu einer Neuanordnung von Teilen der Brüstungsbretter führte.
Aktuelle Berichterstattung

Aussenansicht der Stadtmauer mit Huwilerturm (© Dominique Batschelet)
Aussenansicht der Stadtmauer mit Huwilerturm (© Dominique Batschelet)

Bruchsteinmauerwerk mit Gerüstlöchern, Spuren des bauzeitlichen Baugerüsts (© Dominique Batschelet)
Bruchsteinmauerwerk mit Gerüstlöchern, Spuren des bauzeitlichen ...
Bruchsteinmauerwerk mit Gerüstlöchern, Spuren des bauzeitlichen Baugerüsts (© Dominique Batschelet)

Detailansicht einer Schiessscharte beim Wehrgang (© Dominique Batschelet)
Detailansicht einer Schiessscharte beim Wehrgang (© Dominique Batschelet)

Innenseite der Stadtmauer mit Reparaturen an der Laube von 1654 (© Dominique Batschelet)
Innenseite der Stadtmauer mit Reparaturen an der Laube von 1654 (© Dominique ...
Innenseite der Stadtmauer mit Reparaturen an der Laube von 1654 (© Dominique Batschelet)




Aussenansicht der Stadtmauer mit Huwilerturm (© Dominique Batschelet)
Bruchsteinmauerwerk mit Gerüstlöchern, Spuren des bauzeitlichen Baugerüsts (© Dominique Batschelet)
Detailansicht einer Schiessscharte beim Wehrgang (© Dominique Batschelet)
Innenseite der Stadtmauer mit Reparaturen an der Laube von 1654 (© Dominique Batschelet)
Das Werkstattgebäude des Kurbads Schönbrunn erhält eine neue Nutzung
Bad Schönbrunn in Edlibach war im späten 19. Jahrhundert und bis zum Ersten Weltkrieg ein berühmtes Kurbad. Der Menzinger Dorfarzt Peter Hegglin hatte das quellenreiche Grundstück 1858 erworben und zwei Jahre später die «Wasserheil-Anstalt Bad Schönbrunn» eröffnet, die Gäste aus ganz Europa anzog. Die erhaltenen Teile des Parks sowie mehrere Nebengebäude machen die Kuranlage des 19. Jahrhunderts bis heute erlebbar. Dazu gehören ein Werkstatt- und ein Lagergebäude, die im nordöstlichen Bereich der Liegenschaft, angrenzend an den bewaldeten Hang stehen. Sie wurden 1883 errichtet und sind aneinandergebaut. In den Ökonomiebauten waren ursprünglich ein Waschhaus, ein Schopf und ein Dampfofen für den Kurbetrieb untergebracht. 1930 wurden die Gebäude zu einer Werkstatt mit Lagerhaus umgebaut. Die Holzbauten sind im Erdgeschoss teilweise gemauert und im Äusseren mit vertikalen Holzschalungen verkleidet. Sie zeigen eine zeittypische Gestaltung mit Elementen des Schweizer Holzstils.
Die im Jahr 2022 unter der Leitung von Ruedi Hotz realisierte Sanierung betraf den südlichen der beiden ehemaligen Ökonomiebauten. Er wurde für die Stiftung Zuwebe umgenutzt und dient seither als Verkaufsladen für die Erzeugnisse des von ihr bewirtschafteten Gartens oberhalb des Lassalle-Hauses sowie als Garderobe, Werkstatt und Lager. Das Gebäude wurde sanft restauriert und mit einem neuen Dach versehen. Dabei wurden die Holzverschalung sowie das Mauerwerk repariert und neu gestrichen. Stark beschädigte Teile wurden ersetzt. Türen, Fenster, Fensterläden und Gitter konnten erhalten werden. Sie wurden neu gefasst und wo nötig ertüchtigt. Als Entscheidungsgrundlage für die Wahl der Materialien und Farben untersuchten Restauratoren die Fassaden. Dabei konnten sie von der bauzeitlichen Farbigkeit noch zahlreiche Spuren finden. Es zeigte sich, dass die beiden aneinandergebauten Gebäude ursprünglich farblich verschieden gestaltet waren. Mit der Sanierung wurde die originale Farbgebung wiederhergestellt.
Aktuelle Berichterstattung

Ansicht von Nordwesten (© Philippe Hubler)
Ansicht von Nordwesten (© Philippe Hubler)

Durchgang zwischen den beiden Ökonomiegebäuden (© Regine Giesecke)
Durchgang zwischen den beiden Ökonomiegebäuden (© Regine Giesecke)

Postkarte der «Wasserheilanstalt Bad Schönbrunn» von 1922 mit Werkstattgebäude am linken Bildrand (© ADA Zug)
Postkarte der «Wasserheilanstalt Bad Schönbrunn» von 1922 mit ...
Postkarte der «Wasserheilanstalt Bad Schönbrunn» von 1922 mit Werkstattgebäude am linken Bildrand (© ADA Zug)

Innenraum im Obergeschoss nach der Sanierung (© Regine Giesecke)
Innenraum im Obergeschoss nach der Sanierung (© Regine Giesecke)




Ansicht von Nordwesten (© Philippe Hubler)
Durchgang zwischen den beiden Ökonomiegebäuden (© Regine Giesecke)
Postkarte der «Wasserheilanstalt Bad Schönbrunn» von 1922 mit Werkstattgebäude am linken Bildrand (© ADA Zug)
Innenraum im Obergeschoss nach der Sanierung (© Regine Giesecke)
Ein expressiver Betonbau frisch saniert
Die reformierte Kirche Rotkreuz ist ein bedeutender Vertreter der expressiven, plastischen Kirchenarchitektur der späten 1960er-Jahre im Kanton Zug. Gebaut wurde sie 1969 bis 1971 vom Zürcher Architekten Benedikt Huber, der für seine modernen Kirchenbauten schweizweit bekannt war. Der geschickt auf der Topografie des Hügels angeordnete Kirchenbau erhebt sich über einem aufgefächerten Grundriss und tritt als expressiv modelliertes Sichtbeton-Volumen in Erscheinung. An der nordwestlichen Gebäudeecke ragt ein Turm mit dreiteiligem offenem Geläut aus dem Kirchenraum empor. Ein markantes, eternitverkleidetes Pultdach deckt die Kirche und prägt deren Süd- und Ostansicht. Neben der plastisch geformten, scharf geschnittenen Gebäudehülle kennzeichnet vor allem die «Béton Brut»-Materialisierung mit sägeroher Brettschalungsstruktur die äussere Gesamterscheinung. Im Innern prägen grober Kellenwurf, Sichtbeton, Klinker und Holz den Raumeindruck.
Mit der 2023 abgeschlossenen Sanierung gelang es dem Architekten Oliver Guntli und dem Landschaftsarchitekten Benedikt Stähli, das Bauwerk mitsamt den umgebenden Freiräumen wieder näher an das originale Erscheinungsbild heranzuführen. Zudem wurde die Kirche weitgehend barrierefrei zugänglich gemacht und die sanitären Einrichtungen wurden erneuert. Aufgrund von Rissen und Abplatzungen stand die Sanierung der Betonfassade an, was die Gelegenheit bot, dem etwas verunklärten Fassadenbild wieder einen einheitlichen Ausdruck zu verleihen. Es war ebenso an der Zeit, die spröde gewordenen Eternitschiefer durch neue, asbestfreie zu ersetzen. Im Innern wurden Einbauten, Zwischenböden und Oberflächen, die im Rahmen von früheren Eingriffen angebracht worden waren und nicht der Qualität des Originals entsprachen, entfernt und durch passendere Elemente ersetzt. Auch die Umgebungsgestaltung wurde dank sorgfältiger Eingriffe, wie der Anpassung des Baum- und Heckenbestandes, der Sanierung von Sitzbänken und der Modifizierung des Beleuchtungskonzepts, aufgewertet. Der Vorplatz ist neu mit einem Brunnen des Künstlers Roland Heini ausgestattet.
Aktuelle Berichterstattung

Ansicht von Süden mit Vorplatz und Eingangssituation (© Regine Giesecke)
Ansicht von Süden mit Vorplatz und Eingangssituation (© Regine Giesecke)

Ansicht von Nordwesten mit Kirchturm (© Regine Giesecke)
Ansicht von Nordwesten mit Kirchturm (© Regine Giesecke)

Abgestufter Kirchenraum (© Regine Giesecke)
Abgestufter Kirchenraum (© Regine Giesecke)

Mit Verbundsteinen gepflästerter Vorplatz mit neuem Brunnen des Künstlers Roland Heini (© Regine Giesecke)
Mit Verbundsteinen gepflästerter Vorplatz mit neuem Brunnen des Künstlers Roland Heini ...
Mit Verbundsteinen gepflästerter Vorplatz mit neuem Brunnen des Künstlers Roland Heini (© Regine Giesecke)




Ansicht von Süden mit Vorplatz und Eingangssituation (© Regine Giesecke)
Ansicht von Nordwesten mit Kirchturm (© Regine Giesecke)
Abgestufter Kirchenraum (© Regine Giesecke)
Mit Verbundsteinen gepflästerter Vorplatz mit neuem Brunnen des Künstlers Roland Heini (© Regine Giesecke)
Das ortsprägende Schwendelerhaus wird wiederbelebt
Als Teil des historischen Kirchweilers prägt das Wohnhaus an der Dorfstrasse 13 das Ortsbild im Zentrum von Walchwil. Nach dessen Eigentümerschaft wird es auch «Haus Schwendeler» genannt. Bei dem 1788 errichteten Gebäude handelt es sich um einen zweigeschossigen Blockbau auf gemauertem Sockel mit einem über zwei Geschossen ausgebauten Dachstuhl. Das Schwendelerhaus hat sich – abgesehen von einem nachträglich erstellten Flachdachanbau – in seinem äusseren Erscheinungsbild seit der Bauzeit kaum verändert. Im Inneren weist es eine zeittypische Grundrissorganisation mit Vorder- und Hinterhaus sowie dazwischenliegendem Mittelgang auf. Im Erdgeschoss zeugt die weitgehend intakt erhaltene Stubenausstattung mit Wand- und Deckentäfer, Büffet und Nussbaumtüren von der Wohnkultur des 18. Jahrhunderts.
2021 bis 2023 wurde das Schwendelerhaus unter der Leitung des Architekturbüros Hürlimann + Beck umfassend saniert und energetisch ertüchtigt. Dabei entstanden zwei voneinander unabhängig funktionierende Wohnungen, von denen die obere mit einem neuen Treppenanbau erschlossen wurde. Die Fassaden des Blockbaus wurden gereinigt und Fenstereinfassungen, Fenster und Läden nach Befund neu gestrichen. Beim Dach konnten die wertvollen historischen Ziegel wiederverwendet werden. Die Eigentümerschaft liess im ersten Obergeschoss die originale Raumstruktur, die im 19. Jahrhundert teilweise verändert worden war, wiederherstellen. Dem ursprünglichen Zustand entsprechend bestehen dadurch strassenseitig wieder zwei grosse Räume, was sich auch vorteilhaft auf die Statik auswirkte. Im Rahmen der energetischen Ertüchtigung wurde das Täfer vorsichtig abgenommen und auf der neuen Innendämmung wieder angebracht. Die historischen Böden sowie das Wand- und Deckentäfer wurden sorgfältig restauriert. Neue Einbauten wie Küchen und Bäder wurden im ehemaligen Hinterhaus untergebracht.
Aktuelle Berichterstattung
- Ein Identitätsstifter für das Dorf, in: Denkmal Journal 3, S. 32-39.
- Walchwil, Dorfstrasse 13, «Schwendelerhaus»: Bauuntersuchung, Sanierung und Umnutzung, in: Tugium 2023, S. 64-65.

Ansicht von Osten (© Regine Giesecke)
Ansicht von Osten (© Regine Giesecke)

Mittelgang mit Treppe (© Regine Giesecke)
Mittelgang mit Treppe (© Regine Giesecke)

Innenraum mit restauriertem Täfer (© Regine Giesecke)
Innenraum mit restauriertem Täfer (© Regine Giesecke)

Neue Treppe auf der Rückseite des Gebäudes (© Regine Giesecke)
Neue Treppe auf der Rückseite des Gebäudes (© Regine Giesecke)




Ansicht von Osten (© Regine Giesecke)
Mittelgang mit Treppe (© Regine Giesecke)
Innenraum mit restauriertem Täfer (© Regine Giesecke)
Neue Treppe auf der Rückseite des Gebäudes (© Regine Giesecke)
Die ehemalige Zuger Hauptpost erwacht zu neuem Leben
Die von 1899 bis 1902 errichtete ehemalige Zuger Hauptpost ist ein typisches Beispiel der um die Jahrhundertwende in vielen Schweizer Städten neu errichteten Bundesbauten. Das repräsentative, in Granit und Sandstein ausgeführte Gebäude mit Mansarddach und markanter Zentralkuppel trägt die Handschrift von Theodor Gohl, dem damals obersten Architekten der Direktion der Eidgenössischen Bauten. Es veranschaulicht bis heute die Bedeutung der damaligen Institution Bundespost.
Nach der Schliessung des Postbetriebs 2015 erfolgte von 2018 bis 2022 die Totalsanierung und Umnutzung des Gebäudes unter Regie der Leutwyler Partner Architekten. Als eine der aufwendigsten Arbeiten stellte sich die Restaurierung der Sandsteinfassade heraus, die allseitig grössere Schadensbilder aufwies. Nach der sanften Reinigung mit Wasser wurden stark sandende Bauteile verfestigt, Fehlstellen mit Mörtel aufmodelliert, grössere Risse verpresst, Fugen erneuert und einzelne Bauteile, beispielsweise Teile der Baluster, ersetzt. Eine weitere zeitintensive Arbeit war die Sanierung des Mansarddachs. Dieses wurde wieder mit den historisch belegbaren Materialien, konkret mit Naturschieferplatten und Zinkschindeln, gedeckt. Um dem imposanten Treppenhaus im Innern sein ursprüngliches, repräsentatives Aussehen zurückzugeben, wurden die Terrazzoböden und Stuckdecken in moderner Interpretation und unter Erhalt historischer Reste erneuert. Die Wände wurden gemäss Befund mit dem Stoffgewebe Calicot (eine Art Stofftapete) verkleidet und die Gipssockel ergänzt. Als halböffentlicher Raum bildet das Treppenhaus nun wieder eine Einheit mit dem repräsentativen Äusseren des Monumentalbaus am zentralen Postplatz.
Aktuelle Berichterstattung:
-
Italianità, Grandezza und Zuger Sandstein, in: Denkmal Journal 2, S. 6-13
-
Die ehemalige Zuger Hauptpost erwacht zu neuem Leben, in: Tugium 2022, S. 30-31

Ansicht von Westen (© Regine Giesecke)
Ansicht von Westen (© Regine Giesecke)

Figurengruppe nach der Restaurierung (© Regine Giesecke)
Figurengruppe nach der Restaurierung (© Regine Giesecke)

Treppenhaus nach der Sanierung (© Regine Giesecke)
Treppenhaus nach der Sanierung (© Regine Giesecke)

Terrazzoboden im Treppenhaus mit integriertem, historischem Reststück (© Regine Giesecke)
Terrazzoboden im Treppenhaus mit integriertem, historischem Reststück (© Regine ...
Terrazzoboden im Treppenhaus mit integriertem, historischem Reststück (© Regine Giesecke)




Ansicht von Westen (© Regine Giesecke)
Figurengruppe nach der Restaurierung (© Regine Giesecke)
Treppenhaus nach der Sanierung (© Regine Giesecke)
Terrazzoboden im Treppenhaus mit integriertem, historischem Reststück (© Regine Giesecke)
Ein Speicher zum Wohnen
Das Sennhaus mit Speicher ist Teil der in der Reussebene gelegenen, historischen Hofgruppe Drälikon. Es wurde im späten 18. Jahrhundert als eingeschossiger Ständerbau mit Kantholzfüllung über einem massiven Sockel errichtet. Im Sockelgeschoss befand sich einst die Sennerei, darüber war ein Speicherraum mit Werkstatt untergebracht.
Von 2021 bis 2022 wurde das Ökonomiegebäude vom Architekturbüro Hegglin Cozza Architekten saniert und zum Wohnhaus umgenutzt. Dabei wurde der obere hölzerne Gebäudebereich zu einer zweigeschossigen Wohnung umgebaut, während im massiven Sockel eine Garage sowie eine Waschküche mit Technikraum und Keller eingerichtet wurden. Im Zuge der Umnutzung blieb das historische äussere Erscheinungsbild nahezu unverändert erhalten. Die verputzten Bruchsteinwände wurden innen und aussen instand gestellt, Fehlstellen im Putz ergänzt und die Wände gestrichen. Die Holzwände wurden von aussen nur sorgfältig gereinigt, sodass die Patina erhalten blieb. Die bestehenden Fensteröffnungen waren gross genug, um die Wohnung ausreichend zu belichten. Auf weitere Öffnungen konnte verzichtet werden. Die Aussentreppe aus den 1970er-Jahren wurde in ähnlicher Art erneuert und um ein Podest verlängert, wodurch ein kleiner Aussenplatz vor dem Eingang entstand. Im Innern wurde Alt und Neu zu einer gelungenen Synthese verbunden. Durch die innenliegende Dämmung der Aussenwände entstand eine neue innere Schicht, die deutlich den Wechsel der Nutzung und die zeitgenössischen Anforderungen zeigt. Mit den sichtbar belassenen Trennwänden, Decken, Balken und Türen aus Holz bleibt die historische Bausubstanz auch im Innern weiterhin prägend.

Blick auf die Hofgruppe Drälikon von Süden (© Regine Giesecke)
Blick auf die Hofgruppe Drälikon von Süden (© Regine Giesecke)

Ansicht von Nordosten (© Beni Sutter)
Ansicht von Nordosten (© Beni Sutter)

Wohnung im Hochparterre nach dem Umbau (© Beni Sutter)
Wohnung im Hochparterre nach dem Umbau (© Beni Sutter)

Wohnung im Hochparterre nach dem Umbau (© Beni Sutter)
Wohnung im Hochparterre nach dem Umbau (© Beni Sutter)




Blick auf die Hofgruppe Drälikon von Süden (© Regine Giesecke)
Ansicht von Nordosten (© Beni Sutter)
Wohnung im Hochparterre nach dem Umbau (© Beni Sutter)
Wohnung im Hochparterre nach dem Umbau (© Beni Sutter)
Sanierung der legendären Schulanlage Röhrliberg
Die Schulanlage Röhrliberg wurde in mehreren Etappen in den 1970er-Jahren nach Plänen des Architekten Josef Stöckli errichtet – ein im Kanton Zug namhafter Architekt, der einige Jahre zuvor die Wohnüberbauung Alpenblick realisiert hatte. Stöckli setzte sich mit der Frage auseinander, wie Schulhäuser sich entwickeln und wie sie weitergebaut werden können. 2013 gewannen Marcel Baumgartner Architekten aus Zürich den Wettbewerb für die Sanierung und Erweiterung des Schulhauses.
Die bestehenden Bauten wurden aufgestockt und neue Schulzimmer an den Ecken der Bestandsbauten «angedockt». Diese Verbindung von Alt- und Neubauteilen gelingt hier vorbildlich. Ebenso wurden die von Stöckli für flexible Unterrichtsformen geplanten Mehrzweckbereiche in den Korridoren freigeräumt und weitere Klassenzimmer daran angeschlossen. Zudem wurden die historische Materialität und Farbigkeit (rote Ziegel, Beton, mittelbraune Holzfenster in Sipo sowie kräftig farbige Metalltüren) auch bei der aktuellen Erweiterung übernommen.
Für ein Denkmal ist diese enge Verzahnung von Alt- und Neubau eher eine ungewöhnliche Lösung. Anbauten und Aufstockungen werden bei Schutzobjekten in der Regel sehr zurückhaltend eingesetzt und üblicherweise optisch und baulich deutlicher abgesetzt. Der hier gewählte – und in diesem Fall überzeugende − Weg zeigt, wie wichtig die Einzelfallbetrachtung in der Denkmalpflege ist.
Aktuelle Berichterstattung:
- Weiterbauen, in: Tugium 2021, S. 26-27
- Werner Huber, Natürlich gewachsen, in: Hochparterre 10, 2021, S. 52−59
- Dominique Knüsel, Originaler Ausdruck statt persönlicher Stempel, in: Karton 51, 2021, S. 8−10

Ansicht von Süden nach Umbau (© Roland Bernath, Zürich)
Ansicht von Süden nach Umbau (© Roland Bernath, Zürich)

Eingangsbereich Aula (© Roland Bernath, Zürich)
Eingangsbereich Aula (© Roland Bernath, Zürich)

Schulbereich mit flexibler Einteilung (© Roland Bernath, Zürich)
Schulbereich mit flexibler Einteilung (© Roland Bernath, Zürich)

Klassenzimmer in der neuen Aufstockung (© Roland Bernath, Zürich)
Klassenzimmer in der neuen Aufstockung (© Roland Bernath, Zürich)




Ansicht von Süden nach Umbau (© Roland Bernath, Zürich)
Eingangsbereich Aula (© Roland Bernath, Zürich)
Schulbereich mit flexibler Einteilung (© Roland Bernath, Zürich)
Klassenzimmer in der neuen Aufstockung (© Roland Bernath, Zürich)
Erneuerung des Vielzweckbaus Bommerhüttli im Hürital
Das Bommerhüttli im Hürital ist ein für diese Landesgegend seltenes Vielzweckbauernhaus. Errichtet wurde es in zwei Etappen, konkret 1668 und 1783. Spätestens seit 1813 bestand die ländliche Liegenschaft am Hüribach unter einem einzigen Dach aus Stall, Wohnhaus und Sägebetrieb. Das Konzept für den 2020 erfolgten Umbau durch die Architekten Zumbühl & Heggli beinhaltete zur Hauptsache vier Punkte: Bereinigen – Bewahren – Ertüchtigen – Haus im Haus.
Bereits 2009 wurde ein nordwestlicher Anbau entfernt. Die daraufhin der Witterung ausgesetzte, nordwestliche Fassade und ihre wertvollen alten Balken werden nun neu durch zwei Klebedächer geschützt. In die als Einfamilienhaus konzipierte Liegenschaft wurde im grossräumigen Ökonomieteil zusätzlich eine Einliegerwohnung als Haus im Haus eingebaut.
Die Instandstellung des Blockbaus beinhaltete unter anderem den Ersatz morscher und fauler Holzteile sowie den Wiederaufbau der unteren Scheunenwand mit den Futteröffnungen mit neuem Holz. Der historische Ausbau des Wohnteils mit Türen, Täfer und Kachelofen aus dem 18. Jahrhundert inklusive Stubenfenster aus dem 19. Jahrhundert wurde sorgfältig renoviert und stilecht aufgefrischt. Die Nasszellen für beide Wohneinheiten befinden sich im additiv eingefügten Kubus im Stallteil, wodurch das historische Wohnhaus vor Installationen geschont werden konnte. Das Bommerhüttli zeigt beispielhaft auf, wie ein historisch wertvolles Gebäude erneuert werden kann, ohne seine Identität zu verlieren. So wird es weiterhin die Kulturlandschaft des Hüritals prägen und bereichern.
Aktuelle Berichterstattung:

Ansicht von Süden (© Philippe Hubler Fotografie)
Ansicht von Süden (© Philippe Hubler Fotografie)

Ansicht von Norden (© Philippe Hubler Fotografie)
Ansicht von Norden (© Philippe Hubler Fotografie)

Stubenausstattung nach dem Umbau (© Philippe Hubler Fotografie)
Stubenausstattung nach dem Umbau (© Philippe Hubler Fotografie)



Ansicht von Süden (© Philippe Hubler Fotografie)
Ansicht von Norden (© Philippe Hubler Fotografie)
Stubenausstattung nach dem Umbau (© Philippe Hubler Fotografie)
Weitere Themen
Nicht fündig geworden? Das könnte Sie auch interessieren:
Zuständige Abteilungen
Kontakt
Amt für Denkmalpflege und Archäologie
Montag bis Freitag 08:30 - 11:45 14:00 - 17:00